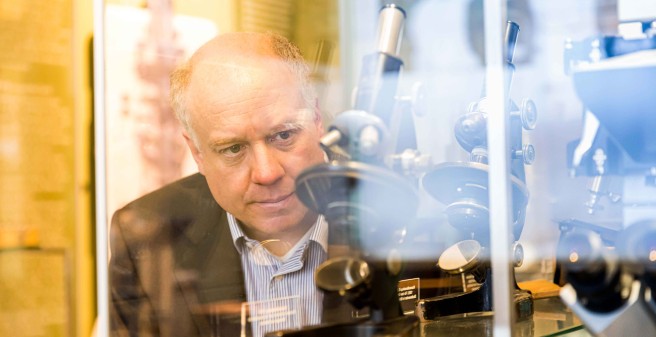Aus der Vergangenheit lernen
Nie hat sich eine Infektionskrankheit so schnell über die Welt verbreitet und so umfassend für Stillstand in Wirtschaft und Gesellschaft gesorgt wie COVID-19. Der Blick in die Vergangenheit, zu Seuchen wie Cholera und Spanischer Grippe, kann dabei helfen, die aktuelle Pandemie zu verstehen und die gesellschaftlichen Reaktionen einzuordnen. Davon ist UKE-Medizinhistoriker Philipp Osten überzeugt.
Der Seuchenexperte leitet das Institut für Geschichte und Ethik der Medizin im UKE, zu dem auch das Medizinhistorische Museum gehört. Beim Umgang mit COVID-19 stützen sich die Forscher auf Erkenntnisse aus der langen Seuchengeschichte. Besonders im Blick: die Spanische Grippe. „Sie dient uns als Folie für COVID-19, denn es ist die letzte große Pandemie, die völlig unerwartet mit einem neuen Erreger kam“, erklärt Prof. Osten. Doch die Aufmerksamkeit für die Spanische Grippe, die nach Schätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO weltweit bis zu 50 Millionen Tote gefordert haben könnte, ist relativ neu. Weil die Krankheit in den USA am besten dokumentiert wurde, gilt heute Kansas im Mittleren Westen als Ursprungsort der Pandemie. Zwar berichteten Mediziner schon 1917 von den Fronten des Ersten Weltkriegs über Grippe-Ausbrüche; in Deutschland aber wurden die Opfer nicht offiziell erfasst. Die Krankheit traf auf eine hungernde Bevölkerung. Ende 1918 hatten Hamburger Ärzte bereits 2500 Grippetote seziert, ihre Warnungen blieben ohne größere öffentliche Resonanz – in der städtischen Statistik ansteckender Krankheiten tauchte die Grippe nicht auf.
Heute orientieren sich das Robert Koch-Institut, die amerikanische Seuchenbehörde CDC (Centers for Disease Control and Prevention) und die WHO mit ihren Krisenplänen an den Erfahrungen der Spanischen Grippe: Hygieneregeln, Schutzmaßnahmen für besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen, behördliche Kommunikation, häusliche Absonderung von Erkrankten und Verdachtsfällen, präventive Schließung von Gemeinschaftseinrichtungen, Verbot von Veranstaltungen – das sind Lektionen aus der Vergangenheit für die Corona-Pandemie.
Schon damals: Bewohner isolieren, um Ausbreitung zu verhindern
Eine aktuelle Infektionskrankheit nach den Maßgaben einer früheren Krankheit zu betrachten, sei auch früher schon üblich gewesen, erklärt Prof. Osten. So habe man etwa versucht, die Cholera asiatica, die seit den 1830er-Jahren auch in Hamburg immer wieder grassierte, „wie die Pest zu beschreiben und mit den gleichen Mitteln einzudämmen.“ Stark betroffene Viertel wurden mit sogenannten Seuchenkordons abgeriegelt, die Bewohner isoliert, um die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern.
Die Wirkung war begrenzt. Dass der Urheber ein Bakterium war, das über verunreinigtes Trinkwasser zu den Menschen kam, wusste man noch nicht. Der Hamburger Wundarzt Johann Carl Georg Fricke, dem eine an das UKE grenzende Straße gewidmet ist, kam der Lösung allerdings schon recht nah: Er hatte im Stadtplan die Wohnorte aller an Cholera verstorbenen Hamburger eingezeichnet, konnte daraus aber noch nicht die richtigen Schlüsse ziehen. Das gelingt erst dem Londoner John Snow, der 1854 ein ähnliches Mapping anfertigt, um den Ursprung der Seuche in seiner Stadt aufzuspüren: Er findet heraus, dass sich die Cholera im Umkreis einer verseuchten Trinkwasserpumpe ausbreitet.
Im Jahr 1892 wird Hamburg noch einmal von einer heftigen Cholera-Welle erfasst, es soll der letzte große Ausbruch in Europa sein. Die Provinz Schleswig-Holstein sperrt rigoros die Grenzen zur Hansestadt – wie unlängst auch in der Corona-Krise, als Autofahrer, die in Richtung Ost- oder Nordsee unterwegs waren, an der Landesgrenze eine Kehrtwende machen mussten. Als Robert Koch, der 1884 den Seuchenerreger beschrieben hatte, im Auftrag der Reichsregierung das Cholera-geschüttelte Hamburg besucht, zeigt er sich entsetzt über die drangvolle Enge und katastrophale Hygiene in den Gängevierteln. Hotspots der Seuche sind St. Pauli und Eimsbüttel; das preußische Altona mit seinem in einer modernen Kläranlage gereinigten Leitungswasser ist seuchenfrei.
Lockdown für die Hansestadt
Robert Koch ordnet für die Hansestadt den Lockdown an: Schulen werden geschlossen, der Hafen steht still, die Stadt ist für Handel und Verkehr gesperrt. Die Bewohner der betroffenen Viertel erhalten nun sauberes Wasser aus dem Fasswagen. Prof. Osten weist in diesem Zusammenhang auf das große Engagement der Stadtbewohner hin: „Bürgerkomitees haben sich gebildet, die die Wasserkästen desinfizierten, Trinkwasser austeilten. Die gesamte kommunale Gesundheitsfürsorge wurde von Ehrenamtlichen geleistet.“ Alle Gewerke seien beteiligt gewesen, darunter Schreiner, Fuhrunternehmer – und Bürger mit Geld. „Das war eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung.“ Die Bilanz der Seuche ist gleichwohl erschütternd: Mehr als die Hälfte der rund 16.600 an Cholera erkrankten Hamburger sterben. In der Folge werden die Gängeviertel saniert und endlich auch eine Sandfiltrieranlage zur Wasseraufbereitung gebaut.
Spanische Grippe: Diagnose erst nach Leichenschau
Seit 1990 ist es dank molekularbiologischer Methoden wie der Polymerasekettenreaktion (PCR) möglich, krankheitsverursachende Viren direkt nachzuweisen. Bei der Spanischen Grippe vor 100 Jahren hatte man die akute Erkrankung nur anhand der Symptome feststellen können; erst nach der inneren Leichenschau stand die Diagnose fest. Und bei der Grippe waren sich Mediziner lange unsicher. Viele glaubten, dass ein Bakterium Urheber der Krankheit sei, doch dieses war nur bei wenigen Toten zu finden. Der neue Sektionssaal des Eppendorfer Krankenhauses, 1918 im Rohbau fertiggestellt, diente als provisorisches Lazarett für die vielen Grippekranken. 1926 wurde der Saal seiner eigentlichen Bestimmung übergeben. Er ist im Medizinhistorischen Museum weitgehend im Originalzustand erhalten.
Die Bedeutung der Sektion als Methode zur Aufklärung von Krankheiten geriet im Zuge der Entwicklung moderner bildgebender Verfahren in Vergessenheit. „Bis vor wenigen Monaten dachten wir, dass wir alles am lebenden Menschen diagnostizieren können“, erklärt Experte Osten. Dieses Paradigma habe sich aber geändert. „Wir arbeiten jetzt mit Methoden wie vor 50 Jahren, um uns an den Erreger heranzutasten.“ In Hamburg werden zurzeit auf Anordnung der Gesundheitsbehörde alle an COVID-19 Verstorbenen des Stadtstaates untersucht. „Es ist eine im wahrsten Sinne des Wortes einschneidende Maßnahme, die für manche Angehörige sehr bitter ist, aber unerlässlich, um die Krankheit zu verstehen.“
Menschen spielen entscheidende Rolle für „zweite Welle“
In der aktuellen Pandemie spielt die Bevölkerung nach Ansicht des UKE-Medizinhistorikers eine größere Rolle als je zuvor: „Sie muss die Eindämmung der Seuche vollziehen, denn außer Abstandhalten und Mund-Nase-Bedeckung gibt es bislang keine gesicherten wirksamen Maßnahmen oder Medikamente.“ Dass die Corona-bedingten Einschränkungen des sozialen Lebens nun abhängig vom regionalen Infektionsgeschehen weiter gelockert oder wieder angezogen werden können, sei sinnvoll. „Wir müssen diese Pandemie jetzt behandeln wie viele kleine, einzelne Epidemien.“
Ob Deutschland sich auf eine zweite Welle einstellen muss? „Nur wenn wir viel Glück haben, kommen wir darum herum“, sagt Osten. „Wir sollten uns immer klar machen, dass dies nicht nur durch den Erreger bedingt ist. Wir machen die Welle selbst, durch unser Verhalten.“ Er plant, der COVID-19-Pandemie im Medizinhistorischen Museum eine Sonderausstellung zu widmen. „Die aktuelle Pandemie lässt sich nicht wie eine historische betrachten“, betont Osten. Eine Ausstellung könnte das Lebensgefühl und den Umgang der Hamburger mit der Seuche und dem damit verbundenen gesellschaftlichem Ausnahmezustand widerspiegeln – anhand von Dingen, die an diese Zeit erinnern: zum Beispiel Desinfektionsmittel, Masken, Handschuhe, Absperrbänder, Abstandsregeln, Fotos und Videos etc.
Das Medizinhistorische Museum auf dem UKE-Gelände ist seit einigen Wochen wieder geöffnet. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Exponaten, Schaubildern und Dokumenten den atemberaubenden Wandel der Medizin seit Ende des 19. Jahrhunderts; an historischen Wachsmodellen (Moulagen) wird die Medizin- und Kulturgeschichte der Syphilis nachvollzogen. Ein weiteres Highlight ist der Sektionssaal, in dessen Rohbau einst die grippekranken Hamburger versorgt wurden.
Museum geöffnet
Das Medizinhistorische Museum ist derzeit sonnabends und sonntags, ab August wieder mittwochs, sonnabends und sonntags von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen: www.uke.de/mmh